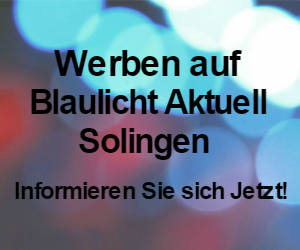Der 40-Jährige drogenabhängige, arbeitslose Deutsche Daniel S. ist am Mittwoch vom Landgericht Wuppertal wegen vierfachen Mordes sowie versuchten Mordes an 20 weiteren Menschen zu lebenslanger Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden – handelt sich dabei um die Höchststrafe. Das Gericht stellte die besondere Schwere der Schuld fest. Außerdem muss Daniel S. an die Angehörigen Schmerzensgeld zwischen 2.000 und 20.000 Euro zahlen.
Der Angeklagte hatte gestanden, im März 2024 in einem Mehrfamilienhauan der Grünewalder Straße ein Feuer gelegt zu haben, bei dem eine bulgarische Familie mit zwei kleinen Kindern ums Leben kam. Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner wurden beim Versuch, sich vor den Flammen zu retten, schwer verletzt. Ebenfalls hatte er die Macheten-Attacke auf einen langjährigen Freund gestanden.
Daniel S. mit persönlichen Worten als Schlusswort
Im Gerichtssaal richtete der Angeklagte im Schlusswort persönliche Worte an die Angehörigen der Opfer: «Durch mein Handeln habe ich unvorstellbares Leid verursacht. Ich bin dafür verantwortlich, dass Angehörige ihre Liebsten verloren haben. Ich kann die Zeit leider nicht zurückdrehen, sondern nur sagen, dass es mir aufrichtig leidtut.»
Überwachungskameras überführten Daniel S.
Im Verlauf des Prozesses wurde bekannt, dass Daniel S. nach einem Streit mit der Vermieterin aus dem Hinterhaus des betroffenen Gebäudes ausgezogen war. In der Tatnacht hatten Überwachungskameras ihn mehrmals mit einem Rucksack in unmittelbarer Nähe des Brandortes erfasst – als einzige Person in dem kritischen Zeitraum. Nur wenige Wochen später verletzte er in einem weiteren Gewaltverbrechen einen langjährigen Freund mit einer Machete schwer.

Brandbeschleuniger bei Durchsuchung gefunden
Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden Ermittler in seinem Keller Brandbeschleuniger und Zündvorrichtungen. Zudem wurde Daniel S. auch für zwei frühere Brandstiftungen verantwortlich gemacht, die sich 2022 und 2024 ereignet hatten. Während des Prozesses rückten zwei weitere mutmaßliche Brandanschläge in den Fokus, darunter ein Feuer in einem Wuppertaler Wohnhaus sowie ein Brandanschlag auf das Auto einer ehemaligen Partnerin.
Schlagabtausch vor der Urteilsverkündung
Im Vorfeld der Urteilsverkündung kam es zu einem scharfen Schlagabtausch zwischen der Nebenklage und der Verteidigung. Rechtsanwältin Seda Başay-Yildiz warf den Ermittlungsbehörden vor, Hinweise auf eine rechtsextreme Gesinnung des Angeklagten zunächst ignoriert oder verharmlost zu haben. «Alles, was rechts sein könnte, wird kleingeredet», kritisierte sie. Erst durch den Druck der Nebenklage seien Nachermittlungen angestoßen und wichtige Beweismittel eingebracht worden.

Rechtsanwältin Başay-Yildiz mit scharfer Kritik
Başay-Yildiz verwies auf ein rassistisches Gedicht, das offen in einer vom Angeklagten genutzten Garage hing, sowie auf digitale Inhalte: Daniel S. habe sich mehrfach rechtsradikale Inhalte angehört, darunter das verbotene Horst-Wessel-Lied, Propagandareden von NS-Größen sowie ein Lied mit der Parole «Deutschland den Deutschen – Ausländer raus». Zudem sei Literatur über führende Nationalsozialisten in einer leerstehenden Wohnung des Hauses gefunden worden, in dem der Angeklagte gelebt hatte.
Auch ein ursprünglicher Polizeivermerk, der die Tat als rassistisch bewertete, sei später abgeändert worden. «Wenn man damals seine Arbeit gemacht hätte, hätten diese Menschen nicht sterben müssen», sagte Başay-Yildiz in Bezug auf das Feuer in der Wuppertaler Normannenstraße im Januar 2022, das nun als gezielte Brandstiftung gilt.
Verteidiger des Mörders mit klaren Worten
Die Verteidiger räumten ein, dass die Nebenklage grobe Ermittlungsfehler offengelegt habe und die Polizei dadurch zu umfassenderen Untersuchungen gezwungen worden sei. Dennoch sahen sie keine belastbaren Hinweise für ein politisch motiviertes Verbrechen.
Von 14.000 Internet-Suchanfragen des Angeklagten hätten lediglich zwölf auf rechtsradikale Inhalte verwiesen. «Es gibt keine konkreten Anzeichen für ein rechtsextremes Tatmotiv», erklärte die Verteidigung. Zudem hätte es für ihren Mandanten keinen Unterschied gemacht, eine entsprechende Gesinnung einzuräumen: «Er kassiert ohnehin die Höchststrafe, das hätte er auch einräumen können.»

Laut Staatsanwaltschaft keine rechte Radikalisierung
Auch die Staatsanwaltschaft wies auf fehlende Belege für eine ideologische Motivation hin und betonte, dass das digitale Verhalten des Angeklagten rückblickend über zehn Jahre analysiert worden sei – ohne Hinweis auf Kontakte zu extremistischen Gruppen oder Hinweise auf eine schleichende Radikalisierung.
Die Staatsanwaltschaft hatte bereits am Montag die maximale Strafe gefordert. Mehrere Nebenkläger schlossen sich der Forderung an. Trotz eines umfassenden Geständnisses waren im Laufe des Verfahrens zahlreiche neue Erkenntnisse aufgetaucht, die zu intensiven Nachermittlungen führten und das Verfahren prägten.